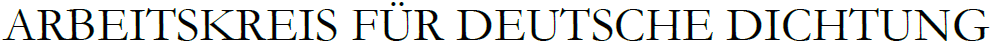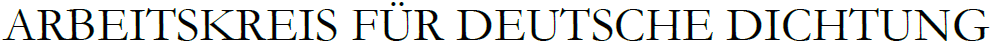Oda Schaefer
Die SeherinWo des Schierlings weiße Kronen,
Giftgesalbte ohne Zucht,
Wuchernd herrschen gleich den Drohnen
Auf dem Boden fremder Frucht,
Steht die Seherin im schwanken
Irren Licht der Nebelzeit,
Festgehalten von den Ranken,
Von dem Dorn der Ewigkeit.
Noch lebt sie in Finsternissen
Mit verdorrtem, taubem Mund,
Fiebernd, wie nach Otterbissen,
Glüht das Auge hell und wund.
Ringsum schweigen Wald und Gräber.
Starre Eichen ragen stumm.
Im Moraste wühlt der Eber,
Geht des Elchs Gehörne um.
Wolfsbrut schläft im tiefen Schatten,
Und es schreit der schwarze Schwan,
Unten kreisen Wasserratten,
Oben zieht des Adlers Bahn.
Da von ferne tönt das hohe
Horn der Windsbraut, kläfft ihr Hund,
Welkes Laub, die gelbe Lohe,
Züngelt auf dem Modergrund.
Mit geschärften Sinnen wittert
Jäh erwacht die Seherin,
Wie die Füchsin jagdlich zittert
Auf der frischen Fährte hin
Nimmt sie in dem starken Rufe
Die verlornen Spuren wahr,
Riesenschritte, harte Hufe,
Totentroß und Rabenpaar.
Und das alte, runde Zeichen
Brennt sie mit dem Feuermal,
Donnernd rollen Räderspeichen
Aus der Götter reichem Saal.
Dem Gehör, dem blinden Sehen
Liegt der Ursprung jetzt entblößt,
Wo der Erde schnelles Drehen
Keim und Zelle aus sich stößt.
Schwindel packt, als wenn sie schwimme,
Sie gleich dunklem Holz im Strom,
Vor dem Schwellen ihrer Stimme
Flieht ins Erz der feige Gnom,
Stockt der Bärin Schlag und Tatze,
Hält der Hirsch im edlen Sprung,
Und der Alben graue Fratze
Lächelt wieder schön und jung.
Schwer, so klirrt im Reim die Sprache,
Hartgepanzert lebt das Wort,
Senkt die Sage in das Brache,
Späten Völkern goldner Hort.
| 

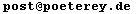
|