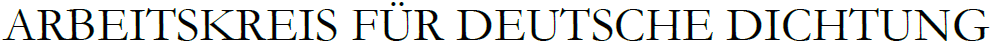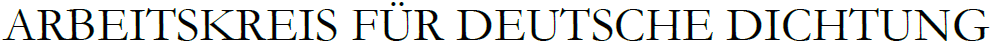Clemens Brentano
Szene aus meinen KinderjahrenOft war mir schon als Knaben alles Leben
Ein trübes träges Einerlei. Die Bilder,
Die auf dem Saal und in den Stuben hingen,
Kannt ich genau; ja selbst der Büchersaal,
Mit Sandrat, Merian, den Bilderbüchern,
Die ich kaum heben konnte, war verachtet,
Ich hatte sie zum Ekel ausbetrachtet.
So, daß ich mich hin auf die Erde legte,
Und in des Himmels tausendförmgen Wolken,
Die luftig, Farben wechselnd oben schwammen,
Den Wechsel eines flüchtgen Lebens suchte.
Kein lieber Spielwerk hatt ich, als ein Glas,
In dem mir alles umgekehrt erschien.
Ich saß oft stundenlang vor ihm, mich freuend,
Wie ich die Wolkenschäfchen an die Erde,
Und meines Vaters Haus, den ernsten Lehrer
Und all mein Übel an den Himmel bannte.
Recht sorgsam wich ich aus, in jenen Höhen
Den kleinen Zaubrer selbst verkehrt zu sehen.
Ich wollte damals alles umgestalten,
Und wußte nicht, daß Änderung unmöglich,
Wenn wir das Äußre, nicht das Innre wenden,
Weil alles Leben in der Waage schwebet,
Daß ewig das Verhältnis wiederkehret,
Und jeder, der zerstört, sich selbst zerstöret.
Dann lernt ich unsern Garten lieben, freute
Der Blüten mich, der Frucht, des goldnen Laubes
Und ehrte gern des Winters Silberlocken.
An einem Abend stand ich in der Laube,
Von der die Aussicht sich ins Tal ergießt,
Und sah, wie Tag und Nacht so mutig kämpften.
Die Wolken drängten sich wie wilde Heere,
Gestalt und Stellung wechselnd in dem Streite,
Der Sonne Strahlen schienen blutge Speere;
Es rollte leiser Donner in der Weite,
Und unentschieden schwankt des Kampfes Ehre
Von Tag zu Nacht, neigt sich zu jeder Seite;
Dann sinkt die Glut, es brechen sich die Glieder,
Es drückt die Nacht den schwarzen Schild hernieder.
Da fühlte ich in mir ein tiefes Sehnen
Nach jenem Wechsel der Natur, es glühte
Das Blut mir in den Adern, und ich wünschte
In einem Tage so den Frühling, Sommer,
Herbst, Winter, in mir selbst, und spann
So weite, weite Pläne aus, und drängte
Sie enge, enger nur in mir zusammen.
Der Tag war hinter Berge still versunken,
Ich wünschte jenseits auch mit ihm zu sein,
Weil er mir diesseits mit dem kalten Lehrer,
Und seinen Lehren, stets so leer erschien.
Der Ekel und die Mühe drückte mich,
Ich blickte rückwärts, sah ein schweres Leben,
Und dachte mir das Nichtsein gar viel leichter.
Dann wünscht ich mich mit allem, was ich Freude
Und wünschenswertes Glück genannt, zusammen
Vergehend in des Abendrotes Flammen.
Der Gärtner ging nun still an mir vorüber
Und grüßte mich, ein friedlich Liedchen sang er,
Von Ruhe nach der Arbeit, und dem Weibe,
Das freundlich ihm mit Speis und Trank erwarte.
Die Vöglein sangen in den dunkeln Zweigen,
Mit schwachen Stimmen ihren Abendsegen,
Und es begann sich in den hellen Teichen
Ein friedlich monotones Lied zu regen.
Die Hühner sah ich still zur Ruhe steigen,
Sich einzeln folgend auf bescheidnen Stegen.
Und leise wehte durch die ruhge Weite,
Der Abendglocke betendes Geläute.
Da sehnt ich mich nach Ruhe nach der Arbeit,
Und träumte mancherlei von Einfachheit,
Von sehr bescheidnen bürgerlichen Wünschen.
Ich wußte nicht, daß es das Ganze war,
Das mich mit solchem tiefen Reiz ergriff.
Des Abends Glut zerfloß in weite Röte,
So löst der Mühe Glut auf unsern Wangen
Der Schlaf in heilig sanfte Röte auf.
Kein lauter Seufzer hallte schmerzlich wider,
Es ließ ein Leben ohne Kunst sich nieder,
Die hingegebne Welt löst sich in Küssen,
Und alle Sinne starben in Genüssen.
Da flocht ich trunken meine Ideale,
Durch Wolkendunkel webt ich Mondesglanz.
Der Abendstern erleuchtet, die ich male,
Es schlingt sich um ihr Haupt der Sternenkranz,
Die Göttin schwebt im hohen Himmelssaale
Und sinkt und steigt in goldner Strahlen Tanz.
Bald faßt mein Aug nicht mehr die hellen Gluten,
Das Bild zerrinnt in blaue Himmelsfluten.
Und nie konnt ich die Phantasie bezwingen,
Die immer mich mit neuem Spiel umflocht;
So glaubte ich auf einem kleinen Kahne
In süßer Stummheit durch das Abendmeer
Mit fremden schönen Bildern hinzusegeln.
Und dunkler, immer dunkler ward das Meer,
Den Kahn und mich, und ach, das fremde Bild,
Dem du so ähnlich bist, zogs still hinab.
Ich ruht in mich ganz aufgelöst im Busche,
Die Schatten spannen Schleier um mein Aug,
Der Mond trat durch die Nacht, und Geister wallten
Rund um mich her, ich wiegte in der Dämmrung
Der Büsche dunkle Ahndungen, und flocht
Aus schwankender Gesträuche Schatten Lauben
Für jene Fremde, die das Meer verschlang.
Und neben mir, in toter Ungestalt,
Lag schwarz wie Grab mein Schatten hingeballt.
Und es schien das tiefbetrübte
Frauenbild von Marmorstein,
Das ich immer heftig liebte,
An dem See im Mondenschein,
Sich mit Schmerzen auszudehnen,
Nach dem Leben sich zu sehnen.
Traurig blickt es in die Wellen,
Schaut hinab mit totem Harm,
Ihre kalten Brüste schwellen,
Hält das Kindlein fest im Arm.
Ach, in ihren Marmorarmen
Kanns zum Leben nie erwarmen!
Sieht im Teich ihr Abbild winken,
Das sich in dem Spiegel regt,
Möchte gern hinuntersinken,
Weil sichs unten mehr bewegt,
Aber kann die kalten, engen
Marmorfesseln nicht zersprengen.
Kann nicht weinen, denn die Augen
Und die Tränen sind von Stein.
Kann nicht seufzen, kann nicht hauchen,
Und erklinget fast vor Pein.
Ach, vor schmerzlichen Gewalten
Möcht das ganze Bild zerspalten!
Es riß mich fort, als zögen mich Gespenster
Zum Teiche hin, und meine Augen starrten
Aufs weiße Bild, es schien mich zu erwarten,
Daß ich mit heißem Arme es umschlingen
Und Leben durch den kalten Busen dringe.
Da ward es plötzlich dunkel, und der Mond
Verhüllte sich mit dichten schwarzen Wolken.
Das Bild mit seinem Glanze war verschwunden
In finstrer Nacht. In Büsche eingewunden,
Konnt ich mit Mühe von der Stelle schreiten.
Ich tappe fort, und meine Füße gleiten,
Ich stürze in den Teich. Ein Freund von mir,
Der mich im Garten suchte, hört den Fall,
Und rettet mich. Bis zu dem andern Morgen
War undurchdringlich tiefe Nacht um mich,
Doch bleibt in meinem Leben eine Stelle,
Ich weiß nicht wo, voll tiefer Seligkeit,
Befriedigung und ruhigen Genüssen,
Die alle Wünsche, alle Sehnsucht löste.
Als ich am Turm zu deinen Füßen saß,
Erschufst du jenen Traum zum ganzen Leben,
In dem von allen Schmerzen ich genas.
O teile froh mit mir, was du gegeben,
Denn was ich dort in deinem Auge las,
Wird sich allein hoch über alles heben.
Und kannst du mir auf jenen Höhen trauen,
So werd ich bald das Tiefste überschauen.
Ich glaube, daß es mir in jener Nacht,
Von der ich nichts mehr weiß, so wohl erging,
Als ich erwachte, warf sich mir die Welt
Eiskalt und unbeweglich hart ums Herz.
Es war der tötende Moment im Leben,
Du, Tilie, konntst allein den Zauber heben.
Mein Vater saß an meinem Bette, lesend
Bemerkte er nicht gleich, daß ich erwachte.
Es stieg und sank mein Blick auf seinen Zügen
Mit solchem Forschen, solcher Neugierd, daß
Mir selbst vor meiner innern Unruh bangte.
Dann neigte er sich freundlich zu mir hin
Und sprach mit tiefer Rührung: Karl, wie ist dir?
Ich hatte ihn noch nie so sprechen hören,
Und rief mit lauten Tränen aus – O Vater!
Mir ist so wohl, doch, ach! die Marmorfrau –
Wer ist sie? – Wessen Bild? – Wer tat ihr weh?
Daß sie so tiefbetrübt aufs holde Kind,
Und in den stillen See hernieder weint?
Mein Vater hob die Augen gegen Himmel,
Und ließ sie starr zur Erde niedersinken,
Sprach keine Silbe und verließ die Stube.
In diesem Augenblicke fiel mein Los.
Ein ewger Streit von Wehmut und von Kühnheit,
Der oft zu einer innern Wut sich hob,
Ein innerliches, wunderbares Treiben
Ließ mich an keiner Stelle lange bleiben.
Es war mir Alles Schranke, nur wenn ich
An jenem weißen Bilde in dem Garten saß,
War mirs, als ob es alles, was mir fehlte,
In sich umfaßte, und vor jeder Handlung,
Ja fast, eh ich etwas zu denken wagte,
Fragt ich des Bildes Widerschein im Teiche.
Entgegen stieg mir hier der blaue Himmel,
Und folgte still, wie die bescheidne Ferne,
Der weißen Marmorfrau, die auf dem Spiegel
Des Teiches schwamm. So wie der Wind die Fläche
In Kreisen rührte, wechselte des stillen
Und heilgen Bildes Wille, und so tat ich.
| 

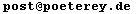
|